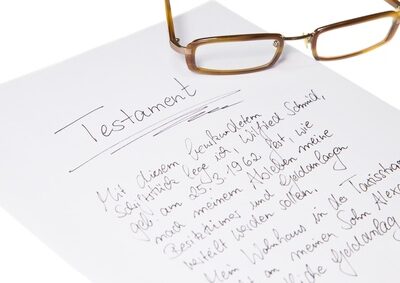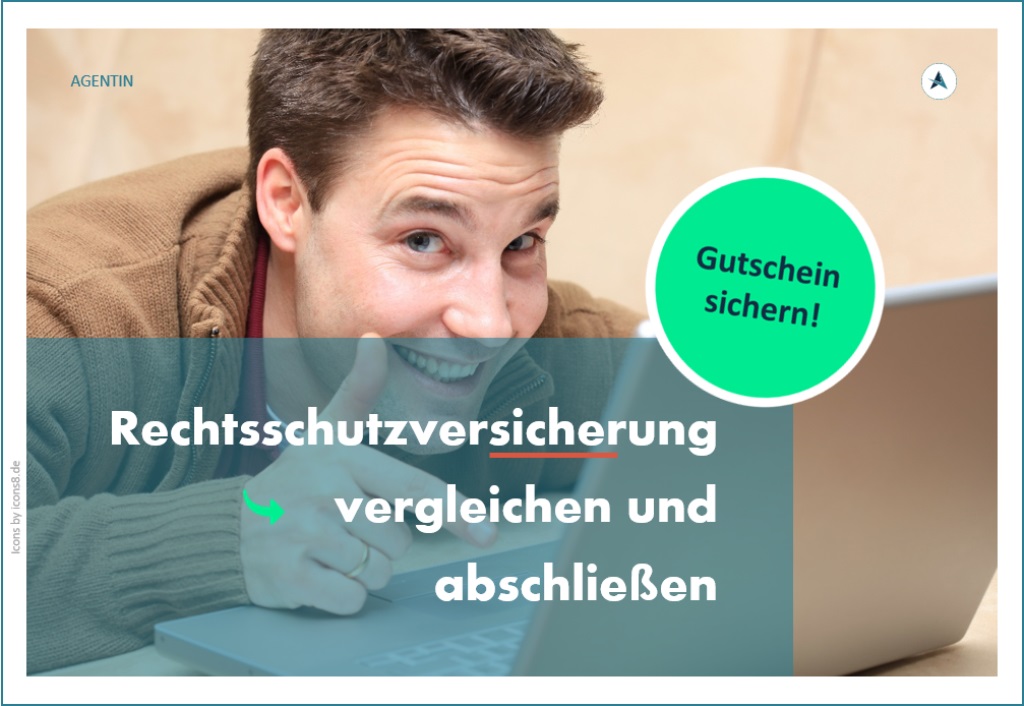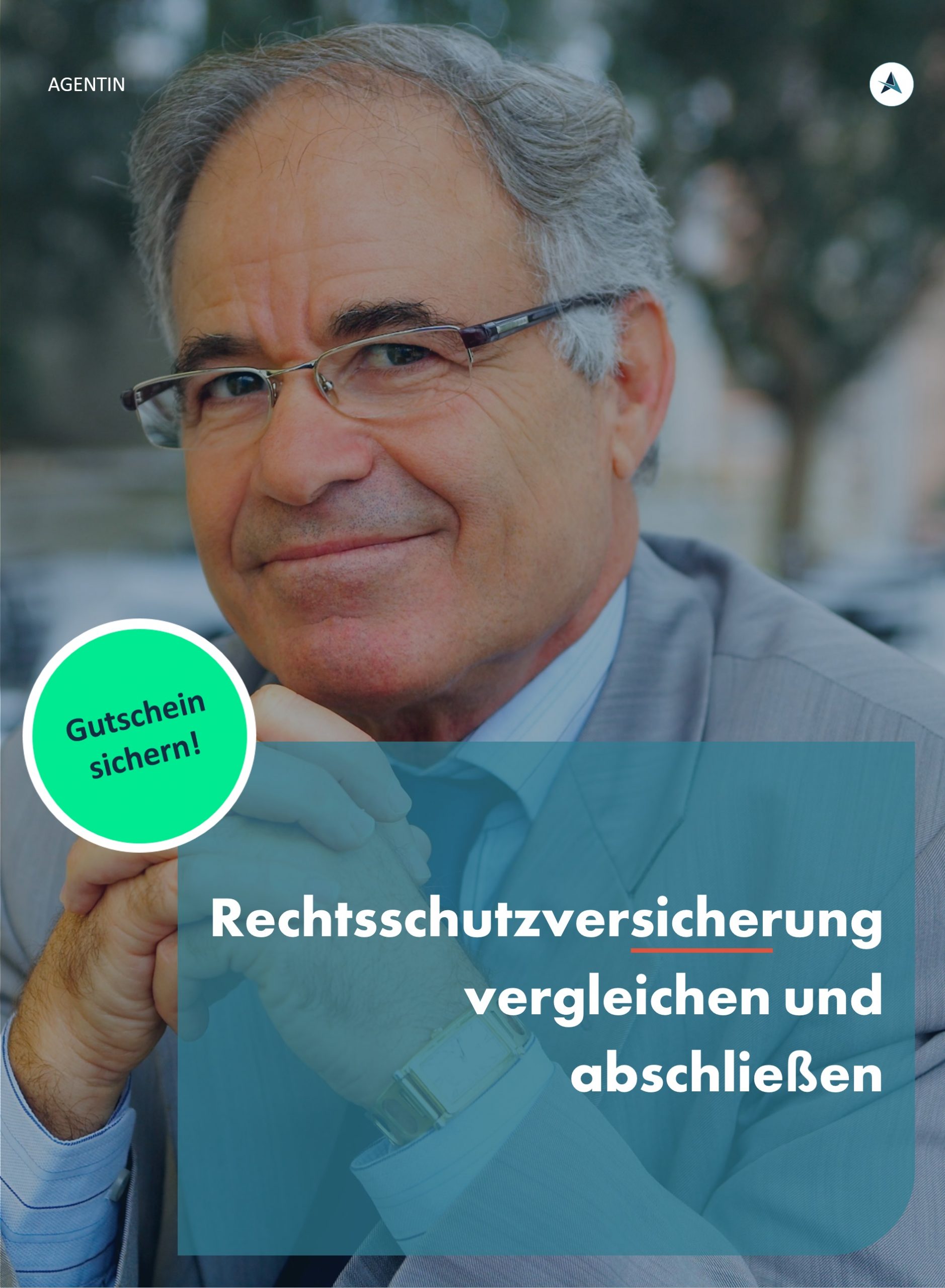Auch oder gerade weil der Erblasser ein Testament errichtet hat, kommt es zu Streitigkeiten. Manchmal hätte der Erblasser einen solchen Streit vermeiden können, wenn er bei der Abfassung des Testaments sorgfältiger gewesen wäre.
In dem vom OLG München am 13.09.2011 (Az.: 31 Wx 298/11) entschiedenen Fall hatte der Erblasser seine Lebensgefährtin testamentarisch zur Alleinerbin eingesetzt. Auf dem unter der Unterschrift verbleibenden Raum von ca. zwei Zentimetern auf dem DIN A 4-Blatt setzte er etwa vierzehn Tage später hinzu: „Voraussetzung:
Die „Name der Lebensgefährtin“ hat das gleiche Testament für mich geschrieben.“ Es folgen Ort und Datum, aber keine weitere Unterschrift.
Auf der Rückseite des Testamentes vermerkte er „Das Testament ist zur Zeit nicht gültig. Bis heute 05/03/07 hat meine Lebensgefährtin kein Testament – wie ich es verfasst * habe – umgekehrt geschrieben.“
Auch diesen Zusatz unterschrieb er nicht. Das Nachlassgericht bewilligte einen Erbschein zugunsten der Lebensgefährtin. Die dagegen gerichteten Rechtsmittel eines der Kinder blieben ohne Erfolg.
Das Oberlandesgericht führte dazu aus:
Der Erblasser könne ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten (§ 2247 Abs. 1 BGB). Die zwingend erforderliche Unterschrift müsse grundsätzlich am Schluss des Textes stehen.
Sinn und Zweck dieser Regelung sei es, die Identifikation des Erblassers zu ermöglichen, zu dokumentieren, dass der Erblasser sich zu dem über der Unterschrift befindlichen Text bekenne, sowie den Urkundentext räumlich abzuschließen und damit vor nachträglichen Ergänzungen und Zusätzen zu sichern.
Ein Testament könne auch in mehreren Teilzügen errichtet werden. Für die Formgültigkeit käme es insoweit nur darauf an, dass im Zeitpunkt des Todes eine die gesamten Erklärungen nach dem Willen des Erblassers deckende Unterschrift vorhanden sei. Eine solche den gesamten Text deckende Unterschrift des Erblassers sei in diesem Fall allerdings nicht vorhanden.
Ergänzungen des Testaments, die von der Unterschrift des Erblassers räumlich gesehen nicht gedeckt seien, müssten grundsätzlich der Form des § 2247 BGB genügen und daher vom Erblasser besonders unterzeichnet werden.
Ausnahmen von diesem Grundsatz kämen in Betracht, wenn Zusätze zwar unter die Unterschrift gesetzt werden, der Bezug zu dem über der Unterschrift stehende Text aber so eng sei, dass dieser erst mit dem Zusatz sinnvoll werde, z. B. wenn das Testament ohne die vorgenommenen Ergänzungen lückenhaft, unvollständig oder nicht durchführbar wäre und der Wille des Erblassers nur aus beiden vom Erblasser niedergeschriebene Erklärungen ersichtlich werde.
Eine solche Ausnahme läge hier nicht vor. Auch stellten weder der Zusatz auf der Vorderseite der Urkunde noch der Vermerk auf der Rückseite einen teilweisen Widerruf der letztwilligen Verfügung dar.
Nach § 2255 Satz 1 BGB könne ein Testament auch dadurch widerrufen werden, dass der Erblasser in der Absicht es aufzuheben, die Testamentsurkunde vernichtet oder an ihr Veränderungen vornimmt, durch die der Wille, eine schriftliche Willenserklärung aufzuheben, ausgedrückt zu werden pflegt.
Eine solche Veränderung müsse an der Urkunde selbst vorgenommen sein, etwa durch Einreißen, Einschneiden, Durchstreichen, Korrekturen oder Ungültigkeitsvermerke.
Die späteren Hinzufügungen des Erblassers zu dem Urkundstext stellen jedoch keine Veränderungen dar, die für jedermann erkennbar zum Ausdruck bringen würden, dass die Urkunde nach dem Willen des Erblassers nicht mehr gelten solle, so die Richter. Änderungen und/ oder Ergänzungen des Testamentes sollten daher grundsätzlich von dem oder den Testierenden unterschrieben werden.
Ausnahmsweise kann auch die Oberschrift eines Testamentes formwirksam sein. In dem vom OLG Celle am 06.06.2011 (6 W 101/11) entschiedenen Fall war das Blatt nach dem Text des Testamentes und dem für die Unterschriften der drei Zeugen vorgefertigten Zeilen voll und ermöglichte keine weitere Unterschrift durch die Testierenden mehr. Die Eheleute unterschrieben deshalb oberhalb des Textes.
Zuerst die Ehefrau, die auch das Testament errichtet hatte, und daneben der Ehemann und Erblassers. Dabei verwendete er denselben Schreibstift wie auch eine der Zeuginnen. Nach dem Gesamtbild kamen die Richter zu dem Schluss, dass es sich um ein formwirksames gemeinschaftliches Testament handelte und wiesen das Amtsgericht an, zugunsten der Ehefrau einen Erbschein zu erteilen.
Kategorieübersicht des Experten Janke und Kloth
Familienrecht
Verkehrsrecht
Reiserecht
Weitere Beiträge der Experten: » Janke und Kloth » Unternehmensprofil
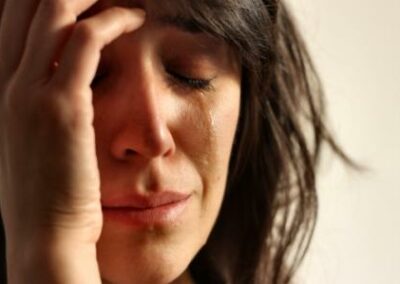
Grabpflegekosten vermindern nicht den Pflichtteilsanspruch

Erben dritter Ordnung

Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testaments

Handschriftliches Testament – Zusätze

Nichtbetreiben eines Scheidungsantrags und Ehegattenerbrecht

Wiederheirat und ein altes Testament
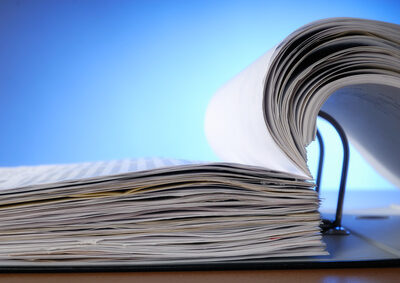
Umfang des Anspruchs des Pflichtteilsberechtigten auf Einsicht in Nachlassakten

Regelungen zum Erbrecht nichtehelicher Kinder, die vor dem 01.07.1949 geboren worden sind

Bezugsberechtigung bei einer Lebensversicherung

Pflichtteilsergänzungsanspruch auch für Schenkungen vor der Geburt

Keine Klage des Miterben gegen den erklärten Willen der anderen

Keine anonyme Beerdigung ohne den Willen des Verstorbenen
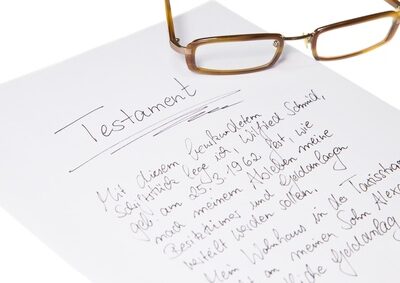
Beitritt zu gemeinschaftlichen Testament auch später möglich
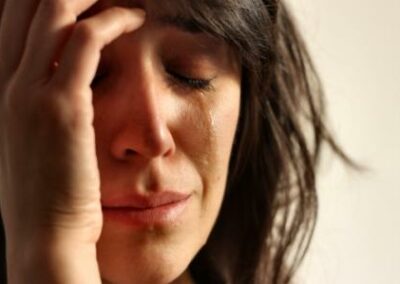
Grabpflegekosten vermindern nicht den Pflichtteilsanspruch

Erben dritter Ordnung

Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testaments

Handschriftliches Testament – Zusätze

Nichtbetreiben eines Scheidungsantrags und Ehegattenerbrecht

Wiederheirat und ein altes Testament
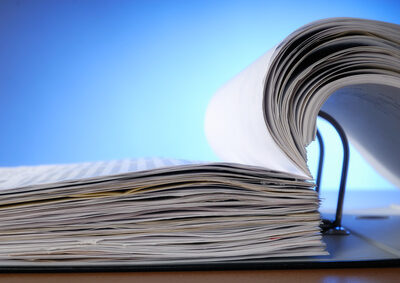
Umfang des Anspruchs des Pflichtteilsberechtigten auf Einsicht in Nachlassakten

Regelungen zum Erbrecht nichtehelicher Kinder, die vor dem 01.07.1949 geboren worden sind

Bezugsberechtigung bei einer Lebensversicherung

Pflichtteilsergänzungsanspruch auch für Schenkungen vor der Geburt

Keine Klage des Miterben gegen den erklärten Willen der anderen

Keine anonyme Beerdigung ohne den Willen des Verstorbenen